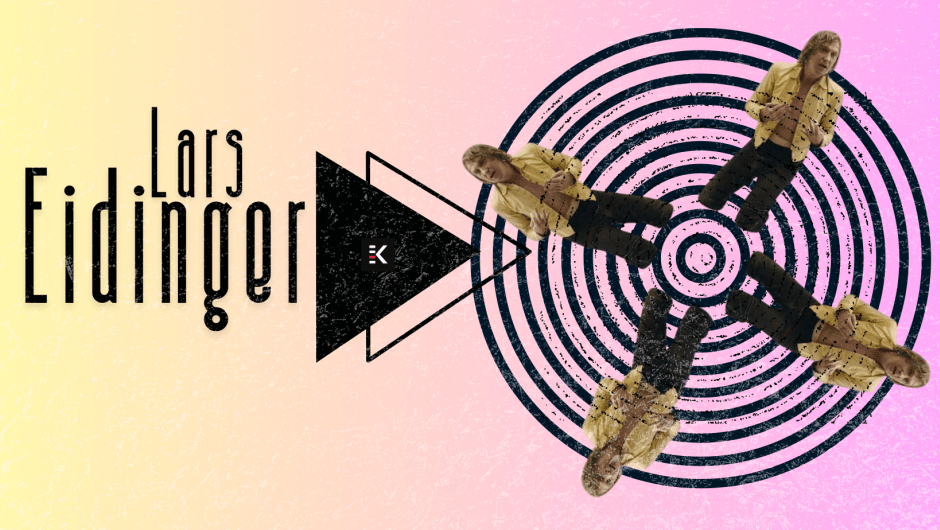
Lars Eidinger: Das langsame Begreifen
Ein Beitrag von Patrick Fey
Lars Eidinger ist der bunte Hund der deutschen Filmlandschaft. Beharrlich stürzt er sich mit all seiner körperlichen Kraft in die Theaterstücke und Filme. Wie lässt sich dieser ungreifbare Mensch begreifen?
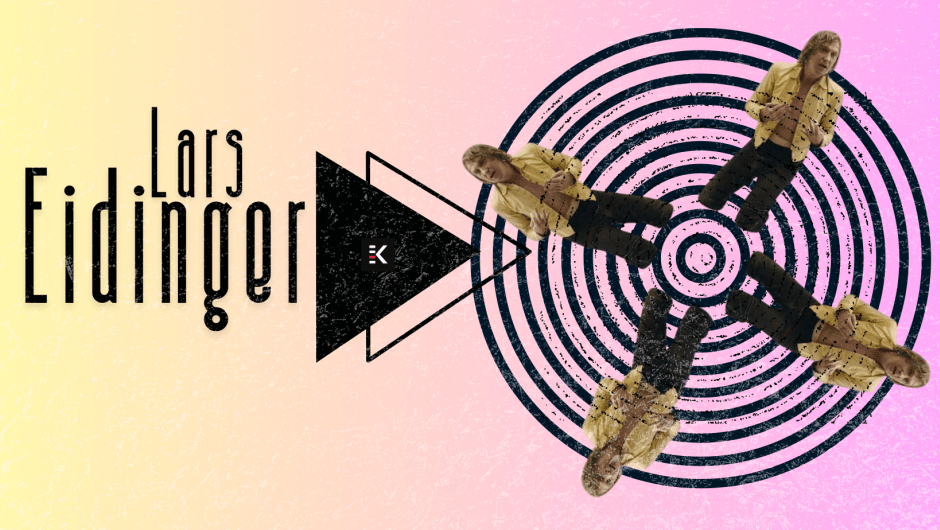
Wenn dieser Tage in den deutschen Kinos Matthias Glasners neuer Film „Sterben“ anläuft, der dem Hamburger Autorenfilmer bei der Berlinale 2024 den Silbernen Bären für das beste Drehbuch bescherte, dann lässt sich getrost ein match made in heaven konstatieren. Das ‚Match‘ beschreibt die Zusammenarbeit des maximalistischen Filmemachers Glasner mit Lars Eidinger, dem, wie es so oft heißt, polarisierendsten deutschen Schauspieler unserer Zeit. Was genau es ist, woran sich das Publikum in der Causa Eidinger scheidet, ist indes nicht leicht auszumachen. Sicher, da sind jene, die ihm das öffentliche Zurschaustellen der eigenen Figur ankreiden. All jene, die mit Blick auf Eidinger nur Eitelkeit und Geltungssucht erkennen. Doch wollte man ausgerechnet diese Eigenschaften—ungeachtet dessen, ob sie nun zutreffen oder nicht—einem Schauspieler wirklich zum Vorwurf machen? Noch dazu, da dieser sie in der Öffentlichkeit doch mehr oder minder bereitwillig eingesteht?
Was seine Hauptdisziplin, das Schauspiel angeht, so würden vermutlich nur die wenigsten so weit gehen, dem unlängst 48 gewordenen Eidinger das Talent abzusprechen. Und wie glaubhaft wäre eine solche Aussage überhaupt angesichts des sich zunehmend ausweitenden Kreises an Kollaborateur*innen, mit denen Eidinger im Laufe seiner Filmlaufbahn zusammengearbeitet hat. Unter den Regie-Größen waren dies etwa Maren Ade, Claire Denis, Noah Baumbach oder Olivier Assayas. Von letztem stammt das Zitat, Eidinger sei ein bisschen wie ein Bandmitglied von The Who, das seine Gitarre auf der Bühne zerschmettert. Aus dem Mund Assayas‘, immerhin Bruder eines auf Rockmusik spezialisierten Musik-Kritikers, ist eine solche Analogie als offene Beifallsbekundung zu verstehen. Dreimal arbeitete Eidinger bereits mit dem französischen Auteur zusammen, nach Clouds of Sils Maria und Personal Shopper (beide mit Kristen Stewart) zuletzt für dessen hauseigene Serienadaption seines modernen Klassikers Irma Vep (1996).
Auch die Zusammenarbeit mit Baumbach für die 2022 in Venedig angelaufene Don-DeLillo-Verfilmung White Noise hinterließ Eindruck: bei Erdinger, der sich, im Ungewissen darüber, was sich aus seinem ersten großen Hollywood-Engagement ergeben möge, von der ikonischen Jedermann-Rolle bei den Salzburger Festspielen lossagte (und die er ohnehin ein Jahr länger spielte als ursprünglich angedacht), um seinem Kalender Platz für etwaige Anfragen aus dem Ausland Platz einzuräumen; beim Kollegen Adam Driver, der ihn für die Rolle des Reinhold von Rumpel in der Netflix-Serienadaption des Erfolgsromans All the Light We Cannot See vorschlug; vor allem aber auch bei Noah Baumbach, der ihn für seinen derzeit in Arbeit befindlichen Jay Kelly erneut castete — nebst einer illustren Darsteller*innen-Riege um George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern und Riley Keough.
Eine vorbildliche Karriere: mein Beruf heißt, mich nicht zu verstecken
In der Retrospektive auf das bisherige Schaffen des Karrieristen Eidinger scheint der Gang nach Hollywood beinahe ein wenig verspätet, haben sich die kreativen Betätigungsfelder für den gebürtigen Berliner doch von jeher ineinander gefügt, seit er im Jahr 1999 seine klassische Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch abschloss. Unter den Alumni desselben Jahrgangs fanden sich mit Nina Hoss und Devid Striesow zwei weitere Großkaliber der deutschen Schauspiellandschaft, die Eidinger in späteren Projekten Weggefährt*innen blieben.
Der Pfad, der Eidinger — den Sohn einer Krankenpflegerin und eines Ingenieurs für Tiefkühllandschaften, wie man sie etwa bei Discountern vorfindet — nach dem Abitur auf die renommierte hauptstädtische Schauspielschule ziehen würde, schien dabei alles andere als vorgezeichnet. Denn dass er kulturell aus einem bildungsfernen Elternhaus stammt, das sich, so Eidinger, vom Erfolg des Sohnes nicht so recht eine Vorstellung mache, daraus hat Erdinger nie einen Hehl gemacht. Vielleicht auch deshalb, weil es das eigene Schaffen noch einmal aufwertet, wenn man behaupten kann, es aus eigenen Mitteln ganz nach oben geschafft zu haben.
Umso überraschender, aber auch beeindruckender, erscheint da der quasi-nahtlose Übergang von der Schauspielschule auf die Berliner Schaubühne, deren Ensemble er nur ein Jahr später, im Jahr 2000, beitrat. Tatsächlich aber steht dieser paradigmatisch für eine von Widerständen recht freien Laufbahn. Denn obgleich der wohl wichtigste Wegbegleiter seiner Karriere, das Schaubühne-Regie-Urgestein Thomas Ostermeier, Eidinger nicht auf Anhieb ins Herz schloss, so dauerte es nicht lang, bis beide für Ostermeiers Neu-Inszenierung von Dantons Tod im Jahr 2001 zusammenarbeiteten.
Noch im Jahr 2010 gab Ostermeier (der selbst erst ein Jahr vor Eidinger an die Schaubühne gewechselt war und dort, zunächst bis 2009, die Co-Intendanz übernommen hatte, bevor ihm die Aufgabe schließlich allein überantwortet wurde) öffentlich an, in Eidinger Starpotenzial auszumachen. Gemessen am Zeitpunkt dieser Aussage grenzte diese Einschätzung beinahe schon an Untertreibung. Nicht nur hatte Eidinger im Jahr zuvor bereits als der mit seinem Selbstwertgefühl und der eigenen Männlichkeit hadernde Architekt Chris in Maren Ades vielfach prämierten Meisterwerk Alle Anderen aufhorchen lassen. Er hatte überdies in Ostermeiers Hamlet-Inszenierung, weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus, internationale Bekanntheit erlangt.
Dennoch müsse er aufpassen, hatte Ostermeier damals Richtung Eidinger gewarnt, nachdem dieser bei einer Aufführung in Sydney — in einer für ihn nicht untypischen Weise — mehrere Minuten durch die Publikumsreihen geschritten war und, so wollte es scheinen, gar nicht mehr auf die Bühne zurückzukehren gedachte. Das habe etwas Unprofessionelles, seine Mitschauspielenden auf der Bühne so lang warten zu lassen, tadelte Ostermeier. In einem nachfolgenden Gespräch habe sich Eidinger allerdings einsichtig gezeigt, und die Sache war schnell aus der Welt geräumt.
Ein pochendes Theaterherz: vor dem anderen statt Nähe das Weite suchen
Was sich in dieser Anekdote kristallisiert, ist, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Schauspiel Eidingers auch immer bedeutet, über den Bühnenschauspieler Eidinger zu sprechen. Nicht nur, weil er der Schaubühne in all den Jahren nie den Rücken gekehrt hat. Laut eigener Aussage erwische er sich während der Sommerpausen gar regelmäßig beim Scrollen durch das Theaterprogramm, wie getrieben von der Hoffnung auf Spielplan-Updates. Mitunter auch, weil er, selbst nie eines Brecht-Zitates verlegen, anhand von Theatertheorie die eigenen ästhetischen Darstellungsprinzipien zu illustrieren versucht, von denen sich dann auch sein Film-Schauspiel ableitet.

Demnach sei all das, was sich auf der und um die Bühne herum abspiele, wortwörtlich das, was man im Deutschen ‚Unterhaltung‘ nenne: eine Form der Kommunikation zwischen dem Ensemble und dem Publikum. Wenn es dann vorkommt, dass diese Unterhaltung unterbrochen, ja verunmöglicht wird — etwa, wenn vereinzelt Zuschauer*innen vorzeitig den Saal verlassen —, so nimmt Eidinger dies persönlich, bricht die vierte Wand, fordert die Flüchtenden auf, sich zu erklären.
Warum diese offene Konfrontation mit denen, die sich doch mit der Eintrittskarte auch die Möglichkeit erkauft haben, wenige Stunden ins Schweigen entlassen zu werden? Die sich selbst dem reinen Zuhören verpflichtet haben? Eine solche Sichtweise steht Eidingers Auffassung des Theaterraumes als Ort der Begegnung allerdings diametral entgegen. So zumindest sagt er es selbst. Wie eine solche Begegnung allerdings wahrhaft zu erreichen ist, wenn Erdinger doch selbst zugibt, dass er die Menschen eigentlich nicht mag, sie „nur als anonyme Masse, als Publikum“ ertrage? Einleuchtender ist da schon die in ihrer Unumwundenheit entwaffnend aufrichtige Erklärung, dass eine jede den Theatersaal verlassende Person ihn zuvorderst einmal kränke.
2020 hatte das Regiegespann Véronique Reymond und Stéphanie Chuat in ihrem Drama Schwesterlein, das Eidinger mit seiner früheren Kommilitonin Nina Hoss wiedervereinte und im Wettbewerb der Berlinale uraufgeführt wurde, sich entlang einiger offensichtlicher Fakten aus dem Leben der Persona Lars Eidinger an einer ins Pathetische überhöhten Autofiktion versucht. Eidinger spielt hier den Star der Berliner Schaubühne, der es, unter der Regie des von Thomas Ostermeier gespielten David, durch seine Hamlet-Darbietungen zu einiger Berühmtheit gebracht hat und nun, von einer unheilbaren Leukämie-Erkrankung befallen, mit dem Traum von einer letzten großen Inszenierung zurückbleibt.
Den Gedanken, am Ende seines Lebens von der Bühne getragen zu werden, wie es Reymonds und Chuats Film nahelegt, lehnt der reale Eidinger indes ab. Wenn man ihn nach seinem Tod schon wegtrage, so solle dies doch bitte aus seiner Wohnung heraus passieren.
Es ist eine Aussage, die nahezu gewöhnlich anmutet für einen Mann, der im Interview mit der NZZ aus dem Jahr 2020 angab, dass, wenn die dänische Regielegende Lars von Trier von ihm verlangte, sich für eine Szene den Arm abzuhacken, er diese Anweisung erst einmal nicht kategorisch ablehnen würde. Die Faszination, die Eidinger vielerorts auslöst, rührt immer auch daher, dass es zumeist nur schwer auszumachen ist, zu welchem Grad solche Aussagen spontaner Plauderei oder Kalkül folgen. Denn, bei aller vermeintlicher Schmerzbereitschaft für die Kunst: Die Nachricht dürfte auch von Trier erreicht haben, der, obgleich der Offenlegung seiner Parkinson-Krankheit zwei Jahre später, immerhin verkündete, dass noch ein paar gute Filme in ihm stecken würden.
Die Flucht aus dem Zweifel: mich zu finden, indem ich mich verliere
Die Einsicht, dass das Leben der meisten Schauspieler*innen abseits der Kameras und Bühnen von Zurückgezogenheit und Selbstzweifel geprägt ist, mag dieser Tage bereits zum Klischee verkommen sein. Gleichwohl hat Eidinger sie über die Jahre immer wieder bemüht, hält unermüdlich an ihr fest. Vermutlich auch deshalb führt sein Fluchtweg zumeist ins Rampenlicht. „Wenn ich eins nicht mache in meinen Leben, ist es mich rar“, sagte er vor einigen Jahren folgerichtig in einem Fernsehgespräch mit Pierre M. Krause. Teil dieser Direktive ist es auch, die zyklischen Pausen der jeweiligen Kunstformen, in denen Eidinger sich auszudrücken sucht, bewusst durch immer neue Betätigungsfelder kurzzuhalten.
In seiner Megalomanie unerreicht bleibt etwa das an Michelangelo angelehnte Gemälde Die Erschaffung des Lars, für das er sich im Rahmen eines Musikvideo-Drehs der Band Deichkind als menschlicher Pinsel zur Verfügung stellte. Von einem Deckenseil hängend, wurde der nackte Eidinger wiederholt in einen überdimensionierten Farbbottich getaucht, um anschließend über die 170 m² große Leinwand gezogen zu werden. Der monochrome Farbton dieser menschlichen Pinselstriche ist angelehnt an das ikonische Ultramarinblau Yves Kleins, einem der Lieblingskünstler Eidingers.
Dass das Schauspiel trotz zahlreicher Auftritte als DJ, ausstellender Fotograf sowie Mode-Designer im Zentrum seines Schaffens geblieben ist, liegt wohl nicht zuletzt an der unmittelbaren Reaktion, die er auf der Bühne erhält und aus deren Bedeutung für sein Wohlbefinden Eidinger nie einen Hehl gemacht hat. Am Set des in vielerlei Hinsicht wegweisenden Alle anderen wurde Eidinger dies auf beschwerliche Weise bewusst: auf jede Szene, die auf der Bühne für gewöhnlich Applaus nach sich zieht, folgte hier nur nachdenkliches Schweigen der Regisseurin Ade und ihres Drehteams. Nachdem Eidinger seinen Unmut über das fehlende Feedback kundtat, passte man sich den Gewohnheiten des Bühnendarstellers an und begann damit, den abgedrehten Szenen mit Ovationen zu begegnen.
Wenngleich eine solche Anekdote eine gewisse Divenhaftigkeit suggeriert, so setzt Ades nuanciertes und in seiner interpersonellen Komplexität selten erreichtes Beziehungsdrama einer solchen Anschauung einen oft nur schwer erträglichen Realismus entgegen. Bereits hier sind die späteren Markenzeichen des Eidinger‘schen Spiels klar dokumentiert: sei es die Unerschrockenheit vor der Ausstellung der eigenen Sexualität (in einer der wiederkehrenden Szenen sehen wir am unteren Bildrand etwa die Spitze einer sich in die Luft reckenden Erektion) oder der Hang zum puren Körperkino (wer Alle anderen einmal gesehen hat, bei dem wird sich Eidingers kunstvoll-entgleiste Tanz-Szene fortan mietfrei im Hinterkopf einquartieren).
Gleichzeitig macht Ade in ihrem Drehbuch auch davor nicht halt, Eidingers langsam einsetzenden Haarausfall ins Drehbuch zu integrieren, was auf anregende Weise die Beziehung zwischen ihm und seiner Figur Chris verkompliziert. Zudem gehört schon einiges dazu, die Zeilen, die bewusst peinlich angelegt sind, auf eine solche Weise mit Leben zu füllen, dass sie der sozialen Wärme erlaubt, durch die verbale Unbeholfenheit durchzuscheinen. Ja, es ist streitbar, ob Eidinger seither in einem Film solchen Kalibers mitgespielt hat.
Das leise Spiel: die Nähe suchen statt die Ferne
Weitaus weniger kontrovers dagegen ist, dass Eidinger die Filme, in denen er mitspielt, zumeist merklich aufwertet. Zuletzt geschehen in Mathias Glasners neuestem Film Sterben, dem bewundernswert ungezähmten Familienporträt der Familie Lunies, in dessen Zentrum der von Lars Eidinger gespielte Tom steht. Wen er sich denn zum Vorbild genommen habe in der Vorbereitung auf die Rolle des Dirigenten Tom Lunies, wurde Erdinger bei der Berlinale-Pressekonferenz zur Weltpremiere von Sterben gefragt. „Cate Blanchett“, erwiderte Eidinger zum Gelächter der Anwesenden, noch ehe die Fragenstellerin aussprechen konnte. In seinem Verweis auf Todd Fields Tár, in dem die australische Ausnahmeschauspielerin Blanchett mit einem Parforceritt als fiktive Dirigentin Lydia Tár aufwartete, revanchierte sich Eidinger auf indirektem Wege gleichsam auch für eine Lobesbekundung, die ihm Blanchett Jahre zuvor — ebenfalls über die Medien — ausgesprochen hatte, nachdem sie Eidinger in einer Hamlet-Vorstellung in Sydney gesehen hatte.
Im Gegensatz zu Tár oder auch Bradley Coopers Maestro spielt das Orchester als Ort in Glasners Triptychon, das in den Erzählperspektiven zwischen Tom, seiner altersbedingt auf Hilfe angewiesenen Mutter (Corinna Harfouch) sowie seiner Schwester Ellen (Lilith Stangenberg) hin- und herschwankt, eine weitaus untergeordnete Rolle. Stattdessen beweist sich Glasner besonders da als exzellenter Erzähler, wo er es uns nicht durchgehen lässt, wegzuschauen. Etwa, als wir zu Beginn des Filmes dem Besuch eines Krankenkassen-Inspektors beiwohnen, in dessen Präsenz die von Harfouch gespielte Mutter Lissy, durchsetzt von falschem Stolz, alles daran setzt, vom Beamten als fähig und eigenständig wahrgenommen zu werden.
Da Eidingers Tom, ohne besondere Bindung zu seiner Mutter, diese nur noch selten besucht, obliegt es hier einer hilfsbereiten Nachbarin (die, wie nicht schwer zu erraten, ebenfalls vereinsamt ist), Mutter Lissy davon zu überzeugen, dass ein guter Eindruck beim Krankenkassenmann sie dringend benötigtes Pflegegeld kosten würde. Eine solche Schicksalsgemeinschaft, wie sie hier zwischen den Nachbarinnen geschlossen wird, beweist eine Beobachtungsgabe für breitere soziologische Phänomene der überalterten Bundesrepublik.

Überdies zögert Matthias Glasner damit aber auch das unausweichliche Aufeinandertreffen zwischen Lissy und ihrem Sohn Tom hinaus – das Herzstück seines Filmes. Als sich die beiden schließlich zum vielleicht ersten Mal seit Jahrzehnten vollkommen allein am Esstisch wiederfinden, entfaltet sich hier ganz allmählich eine Gesprächsszene, die uns ohne Zweifel als eine der intensivsten Seherfahrungen des Jahres 2024 in Erinnerung bleiben wird. Wird bei Eidinger so oft der körperliche Aspekt des Schauspielens betont — was sich, nicht selten, in totaler Verausgabung, wie sie kaum ein zweiter der hiesigen Darsteller*innen zu leisten in der Lage ist, niederschlägt — so ist diese Szene doch das genaue Gegenteil. In ihr wird sich Eidingers Tom nicht nur seiner emotionalen Leerstellen bewusst, er begegnet auch den von seiner Ratio aufgestellten Grenzen, die es ihm verunmöglichen, diese Flecken mit Leben — das heißt mit Gefühlen — zu füllen.
Die Szene habe bereits mehr oder minder nach dem ersten Take gestanden, verriet Glasner auf der Berlinale-Pressekonferenz. Angesichts der Intensität, die sich wundersamerweise trotz — oder doch gar wegen — der nüchternen Gesprächsführung zwischen der Figur Eidingers und Harfouchs einstellt, ist es allerdings fraglich, wie wiederholungsfähig eine solche Szene überhaupt ist.
Nachdem sie im Kasten gewesen war, sei etwas ganz Unwahrscheinliches passiert, erinnert sich Eidinger. Harfouch, die er schon seit so vielen Jahren kenne, habe ihm plötzlich und für sie ganz untypisch die Hand zum Einschlagen angeboten. Vermutlich spürte auch die Grand Dame des deutschen Filmes, dass sich eine solche Szene nicht alle Tage realisiert, und wie wichtig es ist, diese Situationen anzuerkennen. Während seiner Karriere hat Eidinger oft von solchen Momenten gesprochen, in denen das Gegenüber auf der Bühne oder vor der Kamera es ihm ermöglichte, sich seiner selbst zu vergewissern. Solche Momente seien es, die für ihn die Schauspielerei auszeichne. Bisweilen führte er in diesem Zusammenhang ein Gedicht des verstorbenen Dichters und Filmemachers Thomas Brasch an, deren Lyrik er in der Vergangenheit auch live an der Schaubühne vortrug:
MEIN BERUF HEISST MICH NICHT VERSTECKEN
sondern öffentlich entdecken,
mich zu finden, indem ich mich verliere,
nicht bewahren für mich, finden will ich seit ich lebe
Das langsame Begreifen, die Nähe
suchen statt die Ferne
auch Schmerzen sich von
Gewohntem zu lösen
vor dem anderen statt Nähe das Weite suchen











Meinungen
Immer wieder mit Freude zu lesen. Großartige Arbeit! Danke.