Mavericks
Eine Filmkritik von Sophie Charlotte Rieger
"Live Like Jay" (Die Like A Movie Star)
Wer sich für das Surfen interessiert, kennt ihn: Jay Moriarity, der im Kalifornien der 1990er Jahre die größten Wellen ritt und seine Fans nicht nur durch seine sportlichen Leistungen, sondern ebenso mit seinem sonnigen Temperament derart begeisterte, dass „Live Like Jay“ für viele zum Lebensmotto wurde. Wie so oft ist es gerade der frühe Tod, der Moriarity zu einer Legende machte. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass mit Mavericks nun ein Film über den beliebten Soul Surfer in die Kinos kommt.
Die Mutter (Elisabeth Shue) ist dem Alkohol zugetan, der Vater abgehauen – der kleine Jay Moriarity ist weitestgehend auf sich gestellt und sucht nicht nur nach einer Vaterfigur, sondern vor allem nach etwas, das seinem Leben einen Sinn gibt. In Nachbar Frosty (Gerard Butler), dessen Begeisterung für das Surfen manchmal die Liebe zu Frau und Kind zu überlagern droht, findet er beides. Dennoch zögert der unfreiwillige Ersatzvater, als Jay ihn bittet, ihm das Surfen auf den Riesenwellen bei Mavericks beizubringen. Doch das Talent des Jungen und vor allem sein unbeugsamer Wille beeindrucken Frosty so sehr, dass er schlussendlich doch einwilligt. So wird er für Jay zu einem Lehrer und Begleiter, wohlwissend, dass am Ende der Ausbildung ein lebensgefährliches Abenteuer auf seinen Zögling wartet.
Schöne Strände, wilde Gewässer, strahlende, attraktive Menschen, die zu dramatischer Musik in Zeitlupe die Wogen durchpflügen – wäre dieses Szenario stärker ausgeleuchtet, würde man sich in einer Folge der TV-Serie Baywatch wiederfinden. So aber bleiben David Hasselhoff und seine Rettungsschwimmerkollegen nur eine – zugegebenermaßen nicht sonderlich positive – Assoziation, die sich einfach nicht verdrängen lässt. Zu schön sind die Protagonisten, inklusive der alkoholabhängigen Mutter. Zu vorhersehbar ist die Dramaturgie. Zu inszeniert wirken die Beziehungen der Figuren.
Aber halt! Ganz so einfach lässt sich Mavericksnicht aburteilen, denn schließlich handelt es sich hier um die Verfilmung einer wahren Geschichte. Erstaunlicherweise sind es gerade die Momente, die besonders konstruiert erscheinen, welche auf realen Begebenheiten beruhen. So ist das spannende Finale nicht das Produkt einer cleveren Hollywood-Dramaturgie, sondern die Wiedergabe eines atemberaubenden und in der Tat legendären Ereignisses in der Geschichte des Surfsports.
Der Beigeschmack, das alles schon einmal irgendwo gesehen zu haben, bleibt dennoch bestehen. Ein gestandener Mann, der einen Jungen mit problematischem Familienhintergrund unter seine Fittiche nimmt, um ihn in die Kunst einer sportlichen Disziplin einzuführen, ist wahrlich keine Innovation. Und wie schon Karate Kid muss sich auch Jay zunächst Aufgaben widmen, die mit dem Surfen von Riesenwellen auf den ersten Blick in keinem Zusammenhang stehen. Inhaltlich vergleichbar gestrickten Filmen hat Mavericks aber etwas voraus: das Setting. Die wilde kalifornische Küste mit ihrem mannigfaltigen Antlitz aus grünen Wäldern, steilen Klippen, paradiesischen Sandstränden und mörderischer Brandung bietet eine wunderbare Kulisse für dieses Bio-Pic. Und natürlich lassen die Szenen, in denen Jay und Frosty die imposanten Wellen bezwingen, auch dem Publikum eine kleine Portion Adrenalin in die Adern schießen. Die Kamera von Bill Pope verfolgt auch die Ereignisse auf und im Wasser aus großer Nähe und scheint zuweilen mit auf dem Surfbrett zu stehen. So wird der Zuschauer Teil von Jays Abenteuer und kann bei den riskanten Manövern intensiv mitfiebern.
Die Action aber bildet nur einen Teil des Gesamtkonzepts. In Hinblick auf den filmischen Werdegang der Regisseure Curtis Hanson und Michael Apted, der durch gefühlvolles Kino wie In den Schuhen meiner Schwester oder Nell geprägt ist, wundert es nicht, dass auch Mavericks sich große Mühe gibt, seinen Zuschauern doch zumindest ein paar Tränen abzuringen. Je weiter die Filmhandlung fortschreitet, desto mehr Pathos muten Hanson und Apted ihrem Publikum zu. Es ist schade, dass die Geschichte eines für seine Natürlichkeit bekannten Menschen wie Jay Moriarity in diesem Film derart auf Hollywood-Hochglanz poliert wird.
Schade ist auch, dass neben den beiden Hauptfiguren nur eindimensionale Typen auftreten. Die Frauen sind weitgehend anonyme Verlängerungen der männlichen Protagonisten – die Frau von, die Freundin von, die Mutter von – ohne dass ihnen ein eigener, unabhängiger Charakter zugestanden würde. Ähnlich ergeht es auch dem Antagonisten, dessen Konkurrenzsituation mit Jay zu offensichtlich nicht aus der Geschichte selbst entspringt, sondern lediglich ein Konstrukt darstellt, das der Story einen weiteren Spannungsbogen verleihen soll.
Obwohl der Film in enger Zusammenarbeit mit dem echten Rick „Frosty“ Hesson und Moriaritys Witwe entstanden ist, fällt es schwer, Jay, dem Ruhm und Ehre stets weniger bedeuteten als die Freude am Sport selbst, mit diesem pathetischen Hochglanz-Portrait in Verbindung zu bringen. Auch wenn Mavericks für Hardcore-Fans vielleicht eine angemessene (überlebensgroße) Ehrung darstellt, wird der Film sicher nicht denselben legendären Status erreichen wie der Mann, dem er gewidmet ist.
Aber halt! Ganz so einfach lässt sich Mavericksnicht aburteilen, denn schließlich handelt es sich hier um die Verfilmung einer wahren Geschichte. Erstaunlicherweise sind es gerade die Momente, die besonders konstruiert erscheinen, welche auf realen Begebenheiten beruhen. So ist das spannende Finale nicht das Produkt einer cleveren Hollywood-Dramaturgie, sondern die Wiedergabe eines atemberaubenden und in der Tat legendären Ereignisses in der Geschichte des Surfsports.
Der Beigeschmack, das alles schon einmal irgendwo gesehen zu haben, bleibt dennoch bestehen. Ein gestandener Mann, der einen Jungen mit problematischem Familienhintergrund unter seine Fittiche nimmt, um ihn in die Kunst einer sportlichen Disziplin einzuführen, ist wahrlich keine Innovation. Und wie schon Karate Kid muss sich auch Jay zunächst Aufgaben widmen, die mit dem Surfen von Riesenwellen auf den ersten Blick in keinem Zusammenhang stehen. Inhaltlich vergleichbar gestrickten Filmen hat Mavericks aber etwas voraus: das Setting. Die wilde kalifornische Küste mit ihrem mannigfaltigen Antlitz aus grünen Wäldern, steilen Klippen, paradiesischen Sandstränden und mörderischer Brandung bietet eine wunderbare Kulisse für dieses Bio-Pic. Und natürlich lassen die Szenen, in denen Jay und Frosty die imposanten Wellen bezwingen, auch dem Publikum eine kleine Portion Adrenalin in die Adern schießen. Die Kamera von Bill Pope verfolgt auch die Ereignisse auf und im Wasser aus großer Nähe und scheint zuweilen mit auf dem Surfbrett zu stehen. So wird der Zuschauer Teil von Jays Abenteuer und kann bei den riskanten Manövern intensiv mitfiebern.
Die Action aber bildet nur einen Teil des Gesamtkonzepts. In Hinblick auf den filmischen Werdegang der Regisseure Curtis Hanson und Michael Apted, der durch gefühlvolles Kino wie In den Schuhen meiner Schwester oder Nell geprägt ist, wundert es nicht, dass auch Mavericks sich große Mühe gibt, seinen Zuschauern doch zumindest ein paar Tränen abzuringen. Je weiter die Filmhandlung fortschreitet, desto mehr Pathos muten Hanson und Apted ihrem Publikum zu. Es ist schade, dass die Geschichte eines für seine Natürlichkeit bekannten Menschen wie Jay Moriarity in diesem Film derart auf Hollywood-Hochglanz poliert wird.
Schade ist auch, dass neben den beiden Hauptfiguren nur eindimensionale Typen auftreten. Die Frauen sind weitgehend anonyme Verlängerungen der männlichen Protagonisten – die Frau von, die Freundin von, die Mutter von – ohne dass ihnen ein eigener, unabhängiger Charakter zugestanden würde. Ähnlich ergeht es auch dem Antagonisten, dessen Konkurrenzsituation mit Jay zu offensichtlich nicht aus der Geschichte selbst entspringt, sondern lediglich ein Konstrukt darstellt, das der Story einen weiteren Spannungsbogen verleihen soll.
Obwohl der Film in enger Zusammenarbeit mit dem echten Rick „Frosty“ Hesson und Moriaritys Witwe entstanden ist, fällt es schwer, Jay, dem Ruhm und Ehre stets weniger bedeuteten als die Freude am Sport selbst, mit diesem pathetischen Hochglanz-Portrait in Verbindung zu bringen. Auch wenn Mavericks für Hardcore-Fans vielleicht eine angemessene (überlebensgroße) Ehrung darstellt, wird der Film sicher nicht denselben legendären Status erreichen wie der Mann, dem er gewidmet ist.
Mavericks
Wer sich für das Surfen interessiert, kennt ihn: Jay Moriarity, der im Kalifornien der 1990er Jahre die größten Wellen ritt und seine Fans nicht nur durch seine sportlichen Leistungen, sondern ebenso mit seinem sonnigen Temperament derart begeisterte, dass „Live Like Jay“ für viele zum Lebensmotto wurde.
- Trailer
- Bilder



 Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih Senator Film Verleih
Senator Film Verleih

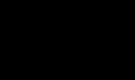





















Meinungen