
„Definiere: Erde“ - Der blaue Planet als Heimat der Menschen
Ein Beitrag von Christian Neffe
Wenn von „Heimat“ die Rede ist, dann ist in der Regel ein Land, eine Stadt oder die eigene Wohnung gemeint. Der Begriff kann aber auch eine globale Dimension annehmen, wie mehrere filmische Beispiele zeigen. Die Rahmenbedingungen sind jedoch selten positiv.

Heimat – was genau ist gemeint, wenn dieses Wort fällt? Das Heimatland? Die Stadt? Das Viertel? Die eigenen vier Wände? Oder die Familie? Wo die englische Sprache deutliche Differenzierungen zulässt (etwa home im Kontrast zu homeland), kann dieses so urdeutsche Wort „Heimat“ völlig unterschiedliche räumliche Ausmaße annehmen. Warum nicht also auch globale?
Diese Idee ist keinesfalls neu: „Und doch sage ich dir, mein liebes Kind: Die Erde ist die Heimat der Menschen, und sie ist eine wunderbare Heimat“, schrieb etwa Astrid Lindgren 1927 in einem Brief an ihren kürzlich geborenen Sohn. Es sind Worte, denen ein zutiefst kosmopolitischer Gedanke innewohnt: Den gesamten Erdkreis als Heimat zu betrachten, als identitätsstiftenden Ort der Geborgenheit, und den Begriff abseits von Provinzialismus und Nationalismus zu denken – war bereits ein Grundpfeiler von Humanismus und Aufklärung. Er scheint, nicht zuletzt durch die Digitalisierung und die dadurch geborene die Phrase vom „globalen Dorf“, in letzter Zeit wieder Konjunktur zu haben. Nicht zuletzt im Kino.
Die Erde als Heimat des Menschen (oder vielmehr: aller Lebewesen) erfahr- und begreifbar zu machen, daran scheinen vor allem klassische Natur-Dokumentarfilme interessiert zu sein – zumindest dem Namen nach. Titel wie Unsere Erde (2007), Unser blauer Planet (2001) oder Die Erde, unsere Heimat (2015) geben die Stoßrichtung bereits vor. Allein durch die Verwendung von Possessivpronomen evozieren sie eine unauflösbare Verbundenheit von Mensch und Umwelt. In ihren Bildern versuchen sie, dem Publikum die „spektakuläre Schönheit“ der Natur begreifbar zu machen, gewähren Einsicht in weit entfernte, exotische Biotope und Habitate – blenden den Mensch dabei jedoch oft aus.
Blick ins Fremde
Zwar dokumentieren sie auch die desaströsen Folgen des Wirkens des homo sapiens — schmelzende Polkappen, Umweltverschmutzung oder gerodete Wälder etwa. Doch machen sie ihn auf diese Weise eben auch zu einem externen Faktor der Diegese: Zwischen Zivilisation und Natur besteht eine implizite Trennlinie und der Blick auf die andere Seite bedient zwar eine intrinsische Neugier am Fremden und Exotischen, löst diese Trennlinie allerdings nicht auf, verstärkt sie durch die Distanz womöglich sogar. Ja, die Elefantenherden in der Savanne, die bunten Vögel der Tropen, die Pinguinhorden mit ihren faszinierenden sozialen Mechanismen – all das gibt es. Doch es bleibt, dank des Blickes der Kamera, auch in weiter Ferne. Ebenso wie globales Verständnis von Heimat.

Nicht unähnlich ergeht es Werken, die den Mensch stärker in den Vordergrund rücken, etwa der assoziative Bildrausch von Koyaanisqatsi (1982) oder Das Salz der Erde (2014), in dem Wim Wenders einen global agierenden Fotografen porträtiert: Sie zeigen das mal symbiotische, mal antagonistische Verhältnis von Umwelt sowie Menschheit und implizieren auf diese Weise deutlich stärkere Verbundenheit beider. Doch die Ereignisse, die sie dokumentieren, sind zeitlich und örtlich gebunden. Ihr Blick ist fragmentarisch, auf lokale Momentaufnahmen beschränkt, aus denen dann – in einigen Fällen – ein globales Gesamtbild entstehen kann. Unter den richtigen Umständen kann der Dokumentarfilm also durchaus ein globales Verständnis von Heimat wecken. Ergiebiger jedoch, so scheint es, ist ein Blick ins Reich der Fiktion.
Rückkehr
Geradezu mustergültig nimmt sich die Pixar-Produktion Wall-E – Der letzte räumt die Erde auf (2008) dieser Idee an. Die dreht sich um einen kleinen Roboter, dem die Aufgabe auferlegt wurde, den von den Menschen verursachten und auf dem ganzen Erdball verteilten Müll in Würfel zu pressen und fein säuberlich zu stapeln, um das zerstörte Ökosystem für die Rückkehr der Menschen aufzubereiten. Die haben es sich derweil auf einem Raumschiff am anderen Ende des Sonnensystems bequem gemacht: In schwebenden Sesseln werden sie vollumfänglich von Service-Robotern bedient und frönen seit 700 Jahren einem durchdigitalisierten Hedonismus, durch den sie inzwischen jeden Bezug zu ihrer Heimatwelt verloren haben.
„Definiere: Erde.“ — Kapitän B. McCrea in Wall-E
Diesen Befehl äußert der Kapitän des Raumschiffes gegenüber der Schiffs-KI nach etwa zwei Dritteln von Wall-E. Es ist der Schlüsselsatz des Films: Was mit einer simplen Erklärung des geologischen Gemisches Erde beginnt, weitet sich – dank des umfangreichen Archivmaterials – schon bald auf die Erläuterung von Naturphänomenen sowie gesellschaftlicher und kultureller Praktiken aus. Sie wecken eine Faszination beim Kapitän, eine Sehnsucht nach der Rückkehr auf einen Planeten, zu dem er, der auf diesem Raumschiff geboren und sozialisiert wurde, im Grunde genommen keinerlei Verbindung hat. „Wir können jetzt nach Hause“, verkündet er schließlich, als die heimtückische Schiffs-KI besiegt ist. Heimat ist in Wall-E nicht abhängig davon, wo man zur Welt kam, sondern wo man sich selbst verortet, weil ein (nicht rational erklärbares) Gefühl von Zugehörigkeit vorherrscht. Ein künstlich geschaffener Ort – so schön er auch erscheinen mag – kann dieses Bedürfnis nicht befriedigen. Sondern nur die Wiege von Leben, Natur und Kultur.
Die Rückkehr zur Erde treibt auch den Astronauten Roy McBride (Brad Pitt) in Ad Astra – Zu den Sternen (2019) an – jedoch weniger seine eigenen, als vielmehr die seines Vaters (Tommy Lee Jones). Der brach vor 36 Jahren zu einer Erkundungsmission ins All auf und gilt seit 20 Jahren als verschollen. McBride wird auf den Mars geschickt, soll Kontakt zu ihm aufnehmen und desertiert schließlich, um seinem Vater noch einmal in die Augen zu blicken. Mit der stillen Hoffnung, ihn tatsächlich nach Hause zu bringen. Jedoch: Die Erde ist hier weniger als Heimat zu verstehen, denn als ein rein geografischer Bezugspunkt in den Tiefen des Alls. Die Heimat, in die McBride zurückkehren will, bedeutet hier stattdessen intakte Familienverhältnisse. Die Sehnsucht nach einer Versöhnung mit dem Vater und der Ex-Frau treiben den Astronauten auf seiner Mission an. Die Reise ins All wird zum Selbstfindungstrip, zur Therapie, über die der emotional unterkühlte Protagonist wieder einen Zugang zu seinem Umfeld findet. Und schließlich zur Überzeugung gelangt, dass er auf der Erde bereits all das hat, was er braucht, um glücklich zu werden. Die Erkenntnis: Erst die geografische Distanz von der Heimat schafft die Sehnsucht nach selbiger. Wo auch sonst soll Heimweh nach der Erde geweckt werden, wenn nicht im All?
Rettung
Phänomene wie Umweltverschmutzung und Klimakatastrophen sowie die dadurch entstandenen sozialen Bewegungen zeigen: Globale Krisen sind imstande, Menschen weltweit für eine gemeinsame Sache zu einen. Dabei wird nicht selten mit dem Narrativ der „einen Heimat“ für die Menschen operiert, die es zu retten gilt. Auch im Kino ist dieses Narrativ präsent – sei es nun die Rettung der Erde oder die der Menschheit (beides geht genau genommen Hand in Hand). Allem voran im Katastrophenfilm. Zerstörungsmeister Roland Emmerich hat dieses Motiv im Laufe seiner Karriere schon zahlreiche Male aufgegriffen, sehr prominent etwa in The Day after Tomorrow (2004) und 2012 (2009), in denen die Menschheit im Angesicht globaler Katastrophen machtlos erscheint.
Weniger ohnmächtig zeigt sie sich in Independence Day (1996), in dem eine weltweite Alien-Invasion als gemeinsames Feindbild und damit als erzählerischer Katalysator für eine länderübergreifende Zusammenarbeit hätte dienen können – würde dieser Gedanken in all dem US-amerikanischen Hurra-Patriotismus nicht gnadenlos ertränkt werden. Guillermo Del Toro sparte sich selbigen in Pacific Rim (2013) und konnte die kosmopolitische Idee von internationaler Zusammenarbeit zur Rettung der gemeinsamen Heimat Erde im Angesicht einer globalen Bedrohung deutlich stärker in sein Werk einbauen.
Zumindest in der Fiktion gilt also: Eine gemeinsame Bedrohung bringt Menschen verschiedenster Nationen und Ethnien dazu, Gräben zu überwinden und zusammen für ihre Existenz und die ihrer Heimat zu kämpfen. Zu dieser Überzeugung gelangt auch der Antagonist in Zack Snyders Watchmen (2009), jedoch ins Fatalistische überspitzt: Er stürzt die Welt ins Chaos und beschuldigt den gottgleichen Superhelden Dr. Manhattan dieser Tat. Der wird zum neuen, weltweiten Feindbild, was den drohenden Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion abwendet. Ob das so auch in der Realität funktionieren würde, dafür steht der Beweis noch aus.
Flucht
Flucht und Migration, zwei der dominanten Themen der öffentlichen Debatte in der jüngeren Vergangenheit, sind untrennbar mit dem Begriff Heimat verbunden: Menschen verlassen ebendiese schweren Herzens, um in einer neuen Wahlheimat ein besseres Leben zu finden. Auch diverse Filme beschäftigen sich mit dieser Thematik – Atlantique (2019), Styx (2018), Transit (2018) und Dämonen und Wunder (2015) seien hier beispielhaft genannt. Doch was, wenn das Glück an keiner Stelle dieses Planeten mehr zu finden ist, weil etwa Ressourcen erschöpft sind oder das Klima kein würdiges Leben mehr möglich macht? Dann bleibt nur noch die Flucht ins All. Eine eindrückliche Verfilmung dieses Gedankens brachte 2019 das chinesische Kino hervor: In Die wandernde Erde (2019) bündelt die Menschheit sämtliche Kräfte, um im Angesicht der sterbenden Sonne dem Kältetod zu entkommen. Ihre Heimat lassen sie jedoch nicht zurück: Mittels gewaltiger Schubdüsen soll der komplette Planet in ein anderes Sonnensystem transportiert werden.
Die Selbstverständlichkeit, mit der der blanke Größenwahn dieses Unterfangens ausgebreitet wird, lässt sich als metaphorische Abwandlung der Erkenntnis lesen, dass die Erde nicht nur eine symbolische Heimat, sondern aufgrund ihrer astronomischen und physikalischen Eigenschaften womöglich die einzig mögliche für die Menschheit ist – ein kosmologisches Privileg. Und die es deshalb um jeden Preis, zur Not auch unter persönlichen Opfern, zu schützen gilt.
Eine neue Heimat
Rückkehr, Rettung und Flucht scheinen also die dominanten Motive zu sein, wenn Filme das Narrativ von der Erde als menschliche Heimat aufgreifen. Christopher Nolans Interstellar (2014), einer der ambitioniertesten Science-Fiction-Filme der vergangenen Jahre, vereint alle drei. Die Erde steht – erneut – am Abgrund. Eine Krankheit lässt Getreidepflanzen sterben und verursacht eine immer größere Nahrungsmittelknappheit, während die Menschheit beständig wächst und unter wiederkehrenden Sandstürmen leidet. Die einzige Lösung scheint die Suche nach einem neuen Heimatplaneten zu sein. Astronaut Cooper (Matthew McConaughey), der die Mission leitet, fasst den grundlegenden Gedanken dahinter schon früh im Film zusammen: Die Erde sei die Heimat der Menschheit – doch das bedeute nicht, dass sie auch dort enden müsse.

Die Suche nach einem neuen Planeten gestaltet sich, wie die Wissenschaftlerin Amelia Brand (Anne Hathaway) feststellt, jedoch schwieriger als „die Suche nach einer neuen Wohnung“. Im Laufe der Mission stellt sich heraus, dass das primäre Ziel nicht die Rettung der Erde und der auf ihr lebenden Menschen, sondern die künstliche Besiedlung eines neuen Himmelskörpers ist – die Flucht vor dem scheinbar Unvermeidlichen also. Was der Hauptmotivation Coopers, die Mission erfolgreich zu beenden, zuwiderläuft: Er will möglichst schnell zur Erde zurückkehren, zu seiner Familie und insbesondere seiner Tochter ( Mackenzie Foy / Ellen Burstyn), um selbige von dem inzwischen lebensfeindlichen Planeten zu retten.
So wie in Interstellar die Relativität der Zeit eine Rolle verhandelt wird, so sehr wird hier auch die Relativität des Begriff Heimat deutlich: Es existiert eine große (die Erde) und eine kleine (Coopers Familie), die miteinander verbunden sind, die verloren oder auch aufgegeben werden können. Und die sich an neuer Stelle wieder aufbauen lassen. Nichtsdestotrotz ist Heimat auch hier ein schützenswerter Ort der Sehnsucht, ein System, dessen Wert man erst erkennt, wenn man sich aus ihm gelöst hat und eine Perspektive von außen neue Erkenntnisse ermöglicht. Was genau Heimat ausmacht und welche Faktoren sie – abseits einer persönlichen Verbindung – definieren, damit setzt sich Interstellar zwar nicht auseinander. Daran ist er aber auch gar nicht interessiert. Denn wie Cooper bereits feststellte: Dass die Menschheit ihren Ursprung auf der Erde hat, bedeutet nicht, dass sie auch dort ihr Ende finden muss. Denn letztlich zählt das, was die Heimat erst zur Heimat macht: die Menschen, die sie bevölkern.
Um den Wert unserer Heimaterde zu erkennen, das zeigen uns diese Filme, bedarf es zuweilen den Blick von außen oder eine existenzielle Bedrohung, im Angesicht derer eine Bündelung von Kräften notwendig ist. Vor allem aber zeigen sie uns: Heimat ist nicht absolut, sondern relativ.
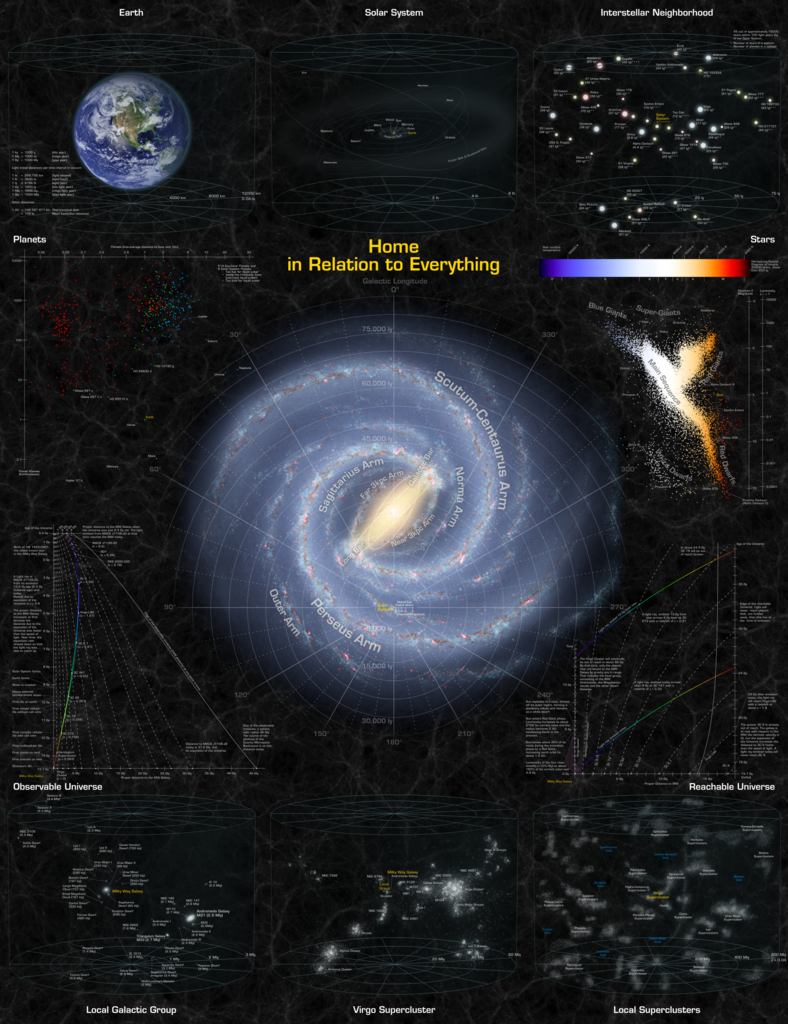








Meinungen