
- Bild ausblenden
- schließen
Fighter (2016)
Beruf? Käfigkämpfer.
Eine Filmkritik von Simon Hauck
Sie kämpfen. Oft sogar im Käfig – und weil sie es wirklich wollen: Blutboxer, offiziell MMA-Sportler genannt, die scheinbar ultimativen Kampfmaschinen des 21. Jahrhunderts, zumindest, wenn es nach ihrem eigenen Image geht. Ihre wenig einladenden Kampfnamen heißen „Pitbull“, „German Tank“ oder „Hooligan“. Inszeniert werden sie in den Arenen wie Computerspielheroen aus Street Fighter oder ebenso bullige wie wendige Genrekinotypen aus einem billigen Chuck-Norris- oder einem frühen Bruce-Lee-Streifen.
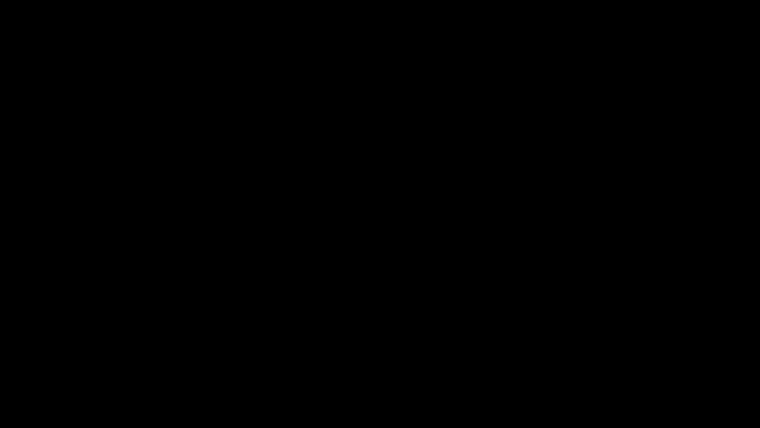
Ihr Kampf zielt einzig darauf ab, den Gegner komplett außer Gefecht zu setzen. Das Regelwerk ist überschaubar – und es darf am Ende, wenn der andere zum Beispiel bereits in den Seilen hängt, weiter wahllos auf ihn eingeschlagen werden. Selbst Würgegriffe sind erlaubt. Kein Zweifel: Diese Mixtur aus (Kick-)Boxen, Judo, Ringen, Karate und Vale Tudo polarisiert wie kaum eine andere Wettkampfart der Gegenwart. Denn nur selten gehen die Fights über die vollen fünf Runden. In den meisten Fällen liegt schon vorher einer der beiden Kontrahenten regungslos am Boden – und das Schiedsrichtergespann bricht den Kampf nicht immer schlagartig ab!
Dafür gibt es zahlendes wie zahlreiches Publikum weltweit: Nur in Deutschland bisher noch nicht, genauer gesagt noch nicht in diesem großen Umfang. Während jene extremen Kampfsportler beispielsweise in Holland, Schweden, England oder den USA länger schon öffentlich als moderne Heldengestalten gefeiert werden, garniert mit dicken Siegerprämien und einer breiten Medienpräsenz, fristet die Mixed-Martial-Arts-Szene im deutschsprachigen Raum bisher immer noch ein ziemliches Schattendasein – trotz hunderter Kämpfer und regelmäßiger Wettbewerbe.
Andreas Kraniotakes ist einer der Kämpfer. Aufgewachsen in ziemlich prekären Verhältnissen, zum Teil auch auf der Straße, hat er als einziger aus seiner Familie Abitur gemacht, später ein Pädagogikstudium erfolgreich beendet, zugleich eine Doktorarbeit angefangen, mittlerweile sogar ein soziologisches Fachbuch veröffentlicht – und sich trotzdem fürs Kämpfen entschieden! Grund dafür ist ein regelrechtes Kindheitstrauma: „Ich wurde immer als letzter gewählt, wenn im Sportunterricht die Mannschaften zusammengestellt wurden.“ Früh schon galt er unter seinen Klassenkameraden als zu dick, zu weichlich, war in deren Augen für wenig zu gebrauchen. Als „Big Daddy“ hat sich der Zwei-Meter-Hüne mit ungewohnten Gentleman-Sitten im Ring als einer der ganz wenigen in Deutschland inzwischen schon so etwas wie einen Namen gemacht. Wer ihn dagegen privat und sozusagen ohne virtuelle Kampfrüstung erlebt – das gelingt der wunderbar intimen Kameraarbeit von Marcus Lenz gleich mehrfach in Susanne Binningers facettenreichem Fighter –, denkt bei seinem überaus gepflegten Erscheinungsbild jedoch nicht gleich an den blutigen Extremsport mit Hau-Drauf-Gebaren, in dem Homophobie offen zelebriert wird und zu dessen Wettkämpfen sich teilweise auch rechtsradikale „Fans“ hin verirren – zum Leidwesen der Veranstalter, die einen sauberen Sport wollen.
Nur ist das im Falle von MMA überhaupt möglich? In einer heftig umstrittenen Sportart, die von nichts weniger als ihren brutalen Schauwerten lebt, die sich überaus gerne an den extremen Hochs und Tiefs ihrer Vertreter erfreut und in toto eben gerade nicht für die Universitätsabschlüsse ihrer Kämpfer berühmt ist? Gerade an diesen durchaus spannenden Schnittstellen bringt Susanne Binningers sehr genaue, fast schon einfühlsame Extremsportstudie viel Licht ins Dunkel.
Denn viele dieser Männer – der Frauenanteil ist weiterhin relativ gering – sind gesellschaftlich nirgendwo verankert in Deutschland, haben entweder Probleme mit der Arbeitssuche oder mit den Ausländerbehörden. Wieder andere aus dieser Szene haben schlichtweg chronisch leere Bankkonten und ansonsten keinerlei Perspektiven vor Augen. Auffallend viele MMA-Fighter haben zudem einen Migrationshintergrund und je nach Stadt oder Bundesland zum Teil auch mit großen Vorurteilen in ihrem Alltag zu kämpfen, was Khalid „The Warrior“ Taha und Lom-Ali „Leon“ Eskijew, zwei weitere Protagonisten aus Fighter, nur allzu gut kennen: unfreiwillig, versteht sich.
Wie Asketen leben sie ausschließlich für den jeweils nächsten Kampf, oft besitzen sie nicht mehr als den Inhalt ihrer Sporttaschen, weil sich die Siegerprämien lediglich um die 200 bis 300 Euro bewegen und im Prinzip nie viel davon zum Leben abseits der Arena übrigbleibt. Und verlieren geht gar nicht! Dann wird der Athlet im Grunde karrieretechnisch um gut ein bis zwei Jahre zurückkatapultiert: Auch davon erzählt Susanne Binningers gut recherchierter und zudem mit viel Sorgfalt entwickelter Dokumentarfilm über die vermeintlich stahlharten großen Jungs, die nach außen hin scheinbar nie erwachsen werden wollen, im engsten Kreis ihrer Familien und Freunde aber durchaus genauso viel Empathie oder Liebe empfinden und weitergeben können wie so genannte „normale“ Sportler.
Im Ganzen sicherlich kein durchweg herausragender Film, aber in jedem Falle ein dokumentarisch angenehm vorurteilsfreier – mit reichlich visueller Schlagkraft und einem absolut gelungenen Sounddesign. Erst recht für die, die sich auf extreme Parallelwelten einlassen können – und schlichtweg mehr hinter dem ganzen Getöse erfahren wollen. Denn im Grunde ist Susanne Binningers Fighter kein reportageartig gedrehter Sport-Event-Film über extravagantes Gepose und brutale Schlägertypen, sondern ein gelungener Versuch, seltsam wirkende Männlichkeitsinszenierungen filmisch intelligent zu hinterfragen.
Quelle: www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/fighter-2016